- Buchbesprechung „Das goldene Tor von Kiew“ – Alexander Rahr
- Vom Potsdamer Geist zum eurasischen und BRICS Markt – Wie Brandenburg und Berlin gemeinsam neue Exportchancen erschließen können
- Film ab: Sommerfahrt mit Präventos – Mit Mozart, Fontane und Whisky durchs Spreewald-Labyrinth
- Deutschlands Demokratie: Die bestgeschützte der Welt – dank einer Verfassung, die keiner Mehrheit gehört, sondern der Menschlichkeit
- Künstliche Intelligenz gegen Fachkräftemangel Ostdeutscher Unternehmertag 2025 in Potsdam zeigt Wege für Wirtschaft und Verwaltung
Buchbesprechung „Das goldene Tor von Kiew“ – Alexander Rahr
- Updated: 9. August 2025
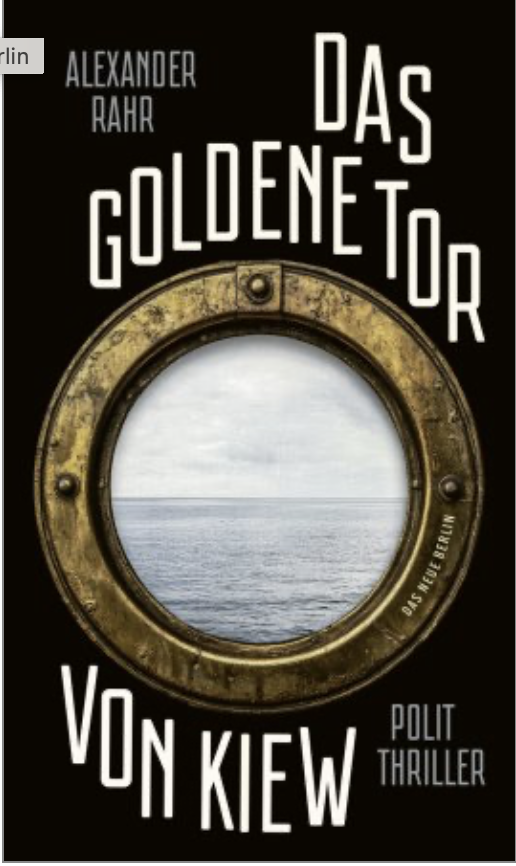
Erstmals hat sich meinbrandenburg.tv an eine Buchbesprechung gewagt – und das aus gutem Grund. Zum einen steht mit zina24.de in Kürze ein neues Erscheinungsbild bevor, zum anderen geben die aktuellen politischen Verwerfungen in Brandenburg, in Deutschland und weit darüber hinaus Anlass zum Nachdenken. Brandenburgs Geschichte ist eng mit der Russlands, aber auch mit der der Vereinigten Staaten verwoben. Heute stehen sich unterschiedliche Lager gegenüber: die „Putin-Versteher“ auf der einen Seite, die „amerikanisierten Freunde“ auf der anderen. Das Problem: Jeder beharrt auf sein Recht und seine Sichtweise.
Doch ist das wirklich so einfach? Was ist richtig, was ist falsch? Klarheit entsteht nur, wenn man bereit ist, sich in beide Perspektiven hineinzuversetzen. Genau das hat Alexander Rahr getan – als Historiker, der beide Welten kennt und in beiden lebt.
Sein Roman ist zwar eine Fiktion, liefert aber eine gedankliche Anleitung, um beide Seiten besser zu verstehen. Er verbindet historische Tiefe mit geopolitischer Spannung – eine ideale Urlaubslektüre, die entspannt und zugleich fesselt.
Besondere Brisanz gewinnt das Buch durch ein aktuelles Ereignis: das geplante Treffen von Präsident Putin und Ex-Präsident Trump in Alaska – eine Szene, die im Roman fast prophetisch mit einem Tunnelbau Plan vor 20 Jahren zwischen beiden Staaten in der Beringsee angedeutet wird.
Erscheinungstermin: 21. August 2025.
Alexander Rahr hat mit „Das Goldene Tor von Kiew“ keinen bloßen Roman, sondern ein vielschichtiges politisch-literarisches Panorama vorgelegt, das weit über die Grenzen eines klassischen Politthrillers hinausgeht. Es ist Geschichtserzählung, Gegenwartsanalyse und Zukunftsprojektion zugleich – eine Mischung aus historischer Tiefenbohrung, geopolitischer Diagnose und spekulativer Vision, die an manchen Stellen sogar ins Science-Fiction-ähnliche reicht. Rahr erzählt zunächst als Roman – mit historischen Rückblenden, dichten Dialogen und feinen Beobachtungen. Doch ab einem bestimmten Punkt wechselt die Erzählung spürbar in den Modus eines Politthrillers: Spionage, Morddrohungen, Erpressung und Gewalt bestimmen das Geschehen.
Ein imaginäres Gespräch als roter Faden
Im Zentrum steht das fiktive Gespräch zwischen einem amerikanischen Starjournalisten und dem russischen Präsidenten. Das Interview bildet jedoch nur die sichtbare Oberfläche – darunter entfaltet Rahr ein Panorama aus russischer und globaler Geschichte, in dem Schauplätze, Persönlichkeiten und Epochen wie auf einer strategischen Weltkarte miteinander verbunden sind. Er verwebt dabei geschickt die unterschiedlichen Sozialisierungen von West und Ost, lässt beide Seiten durch ihre je eigene „Brille“ blicken – und damit auch mit unterschiedlichen Wahrnehmungen und Deutungen. Das regt zum Nachdenken an: Gibt es überhaupt den einen richtigen oder falschen Weg – oder liegt die Lösung am Ende doch im gemeinsamen Handeln?
Rückblick ins Jahr 1625 – Dynastie und Stabilität
Rahr spannt den Bogen bis ins Jahr 1625, als Patriarch Philaret – geistlicher Führer und faktischer Regent – Russland mit harter Hand lenkte. Nach seinem Tod übernimmt Michael I. Fjodorowitsch Romanow (1613–1645) den Thron. In der russischen Geschichtsschreibung gilt er nicht als großer Reformer wie Peter der Große, wohl aber als stabilisierender Herrscher, der das Land nach der „Zeit der Wirren“ wieder festigte. Rahr schreibt dazu: In Russland folgt auf einen Tyrannen oft ein Friedensherrscher. Michael, Begründer der Romanow-Dynastie, steht für diesen Übergang – er brachte Ruhe und Kontinuität, ohne tiefgreifende Reformen einzuleiten. Rahr verschweigt jedoch nicht, dass auch diese Phase von machtpolitischen Verschiebungen geprägt war – mit wachsamem Blick nach Osten, wo China schon damals als Nachbar und potenzieller Gegenspieler in Erscheinung trat.
Der amerikanische Journalist – Beobachter zwischen zwei Welten
Rahr zeichnet den amerikanischen Starjournalisten als Figur, die zwischen professioneller Distanz und persönlicher Irritation pendelt. Er kommt aus einer Welt, in der Fakten, Transparenz und individuelle Freiheit – die zentralen Werte des US-geprägten Kapitalismus – das Fundament politischer Entscheidungen bilden. In Moskau stößt er jedoch auf ein politisches Denken, das tief in kollektiven Erinnerungen, imperialer Geschichte und orthodoxer Kultur verwurzelt ist.
Bereits früh im Gespräch heißt es: „Er wunderte sich. Hier, vor seinen Augen, trafen zwei Welten aufeinander.“ – ein Satz, der nicht nur die Szene beschreibt, sondern sein ganzes Dilemma. Für ihn ist Geschichte ein Archiv, aus dem man lernt; für den russischen Präsidenten ist sie ein Beweisraum, der Handlungen legitimiert.
Gleichzeitig ist er (der Journalist) sich bewusst, „dass er als freier amerikanischer Bürger aus einem Mediensystem kommt, in dem er gewohnt ist, dem Mächtigen Fragen zu stellen und ihn auch öffentlich zu konfrontieren.“
Die Frau aus der Kremladministration warnt ihn, „er müsse sich auf ein ‚knallhartes Duell‘ mit dem Präsidenten einstellen – und spöttelt, er solle aufpassen, nicht selbst „am Nasenring durch die Manege geführt zu werden.„
„Morgenröte in Wladiwostok“ – Begegnung von Ritual und Realpolitik
Mit dem Kapitel „Morgenröte in Wladiwostok“ erreicht die Darstellung der kulturellen Entfremdung ihren eindrücklichsten Moment. Rahr schreibt über das Treffen zwischen dem Journalisten und einem General: „Er traf den General in der Kathedrale des Heiligen Wladimir… Als beide vor dem Altar der majestätischen Kirche standen, verspürten sie den orthodoxen Geist, der sie hier umgab… während die Frauen, abgetrennt, im linken Teil beteten… Sein Gemüt war von Trauer umhüllt, voller Schmerz über die Gräuel des Krieges.“
Der Journalist beobachtet das Ritual, respektiert die Atmosphäre, doch für ihn bleibt es fremd. Er sieht die Frauen, die mit stiller Andacht gegen den Krieg anbeten, und zugleich die Männer, die in diesem sakralen Raum über geopolitische Machtverschiebungen sprechen. Für den Amerikaner ist das ein Widerspruch – für seinen russischen Gesprächspartner eine selbstverständliche Einheit von Glauben, Geschichte und politischem Kalkül.
Dieser Kontrast zieht sich durch den Roman: Wo der Amerikaner wirtschaftliche Abhängigkeiten und internationale Verträge in Dollar- und Prozentwerten denkt, argumentiert der Präsident in Jahrhunderten und Zivilisationslinien. Es ist die Frontalkollision zwischen einer vom Liberalismus und Kapitalismus geprägten Gegenwart der USA – mit ihrem Fokus auf Individualismus, Wettbewerb und kurzfristiger Marktlogik – und einem staatsgelenkten Kapitalismus russischer Prägung, der wirtschaftliche Macht mit politischer Kontrolle und einer geschichtsbewussten, hierarchischen Machttradition verknüpft. Rahr nutzt den Journalisten, um diese Welten immer wieder ungebremst aufeinanderprallen zu lassen.
Schauplätze als Geschichtsspeicher
Auch die historischen Schauplätze sind bei Rahr nicht bloß Kulisse, sondern Träger von Bedeutung. Das Kreml-Ensemble, die Sophienkathedrale von Kiew, die Festung von Smolensk, die Goldenen Tore der Stadt – sie markieren in seiner Erzählung einen Geschichtsraum, der über Jahrhunderte umkämpft war. Die Gebete der Frauen aus Wladiwostok hallen hier wie ein moralischer Gegenpol nach – eine leise Mahnung inmitten jener Stimmen, die nicht das Leid, sondern die geopolitischen Machtverschiebungen sehen: den Moment, in dem Asien Europa überrollt und das demokratische westliche System geschwächt wird.
Gegenwartsbezüge und globale Figuren
Rahr verwebt historische Perspektiven mit aktuellen Bezügen, die streckenweise fast reportageartig wirken. So taucht Elon Musk auf – nicht als Unternehmer, sondern als eine Art „Außenminister“ der globalen Technologiebranche. Der Präsident versichert dagegen im Gespräch: „Russland wird niemals zur sowjetischen Planwirtschaft zurückkehren.“ Auch die Frage nach einer möglichen Nachfolge Putins wird nüchtern verhandelt – zwischen Loyalität, Systemstabilität und der Option eines Kurswechsels.
Doch Rahr bleibt nicht bei Dialogen und Analysen stehen – er lässt seine Figuren selbst zu Protagonisten werden, die in die Handlung hineingezogen werden. Der Berliner Politologe Vetrov erhält in Lissabon einen Forschungsauftrag: Er soll ein Dossier über den Ukraine-Krieg verfassen. Dort trifft er auf einen alten Bekannten – einen russischen General. Ab diesem Moment gewinnt der Roman eine neue Dynamik: Spionage, Morddrohungen, Erpressung und Gewalt rücken in den Fokus. Ein Sog entsteht, der den Journalisten immer tiefer in den Bann zieht – gefangen im ständigen Spannungsfeld zwischen Ost und West.
Fiktion, Realität und die Frage nach der KI-Politik
Auf den letzten Seiten wagt Rahr einen Schritt in die Grauzone zwischen Fiktion und Realität. Er beschreibt fiktive Treffen in den USA, bei denen er russische Agenten mit amerikanischen Gesprächspartnern über die Weltordnung sprechen lässt. Diese Treffen wirken so realistisch, dass man sie für denkbar halten könnte. Hier mündet der Roman in eine philosophische Frage: Können künftige Präsidenten künstliche Intelligenzen sein? Was bedeutet es, wenn politische Entscheidungen von Maschinen getroffen werden, die weder moralische Reue noch menschliche Intuition kennen?
Drei Ebenen, ein Kernkonflikt
Rahr verbindet so drei Ebenen:
- Historie – vom Moskauer Patriarchen Philaret bis zur Morgenröte in Wladiwostok.
- Gegenwart – Musk als geopolitischer Player, Putins Russland, west-östliche Spannungen.
- Zukunft – die Option einer KI-gesteuerten Weltpolitik.
Dazwischen verwebt er den Kernkonflikt des Buches: den unüberbrückbaren Unterschied in der Wahrnehmung zwischen einem westlich sozialisierten Journalisten und einem russisch geprägten Präsidenten. „Er wunderte sich. Hier, vor seinen Augen, trafen zwei Welten aufeinander.“ – Dieser Satz steht nicht nur für die Begegnung im Roman, sondern für das gesamte Verhältnis zwischen West und Ost.
Fazit
Das Goldene Tor von Kiew liest sich damit wie ein dreidimensionales Werk: Es ist Archiv, Analyse und Ausblick in einem – mit Anleihen bei Tolstoi, einem klaren Blick für Machtmechanismen und dem Mut, Geschichte, Gegenwart und Zukunft in einem Erzählstrang zu vereinen. Wer das liest, erkennt, dass Rahrs Roman weniger eine lineare Geschichte ist, als ein politisch-literarisches Prisma – und dass die Ukraine darin nicht nur Kulisse, sondern Spielball eines globalen Schachbretts bleibt, dessen Regeln noch lange nicht neu geschrieben sind.
Wie ich Rahrs Roman erlebt habe – Michael Huppertz
Beim Lesen habe ich das Gefühl, direkt an der Seite des Protagonisten zu stehen – wie der Journalist, der zwei Welten beobachtet, die sich misstrauisch umkreisen. Die Erzählung zieht mich hinein, nicht als distanzierter Leser, sondern als stiller Begleiter, der mit jedem Kapitel mehr versteht: die Gesten, die unausgesprochenen Botschaften, die historischen Fäden, die in die Gegenwart reichen. Rahrs Stil macht es leicht, den Sprüngen zwischen Jahrhunderten und Schauplätzen zu folgen. Die Szenen sind so bildhaft, dass selbst komplexe historische Zusammenhänge wie selbstverständlich Teil der Handlung werden.
Was als Geschichte eines amerikanischen Starjournalisten beginnt, der in der Datscha Stalins auf die russische Wirklichkeit trifft, wird zu einer Reise, auf der sich Kapitalismus und Sozialismus nicht nur als Systeme, sondern als lebendige Gegenspieler vor meinen Augen entfalten. Dabei merke ich, dass sich mein Blick auf Situationen verändert: Es gibt nicht das eine „gut“ oder „schlecht“. Es geht um das Miteinander, darum, dass alle Seiten Kompromisse eingehen, ohne sich selbst aufzugeben. Aufeinander zugehen, gemeinsam miteinander verstehen – das ist die Formel, die als leise, aber klare Quintessenz aus Rahrs Roman mitschwingt. Ganz so, wie es der literarische Pate Tolstoi in Krieg und Frieden vorlebt: am Ende entscheidet nicht allein die Macht über Krieg und Frieden, sondern die Bereitschaft der Menschen, einander zu verstehen.
Michael Huppertz, meinbrandenburg.tv
Alexander Rahr
Das Goldene Tor von Kiew
Politthriller
432 Seiten, 12,5 x 21 cm, gebunden
Erscheinung: 21. August 2025
Buch 30,– €
ISBN 978-3-360-02771-9

Alexander Rahr, 1959 in Taipeh geboren, ist Osteuropa-Historiker, Politologe, Publizist und einer der führenden deutschen Russlandexperten. Von 1982-2015 forschte er an wissenschaftlichen Instituten in den USA, Deutschland, Russland und der Ukraine. 1995-2012 leitete er das Zentrum für Russland, Eurasien an der Denkfabrik »Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik« und beriet die Bundesregierung. Die letzten zehn Jahre arbeitete er als Unternehmensberater (Energiepolitik). Seit 2022 ist er Vorsitzender der Eurasien Gesellschaft in Berlin. Er ist Autor mehrerer Sachbücher, u.a. Biografien von Gorbatschow, Putin und Medwedew. Er veröffentlichte den Politthriller »2054 – Putin decodiert«. Rahr ist Träger des Bundesverdienstkreuzes.







You must be logged in to post a comment Login